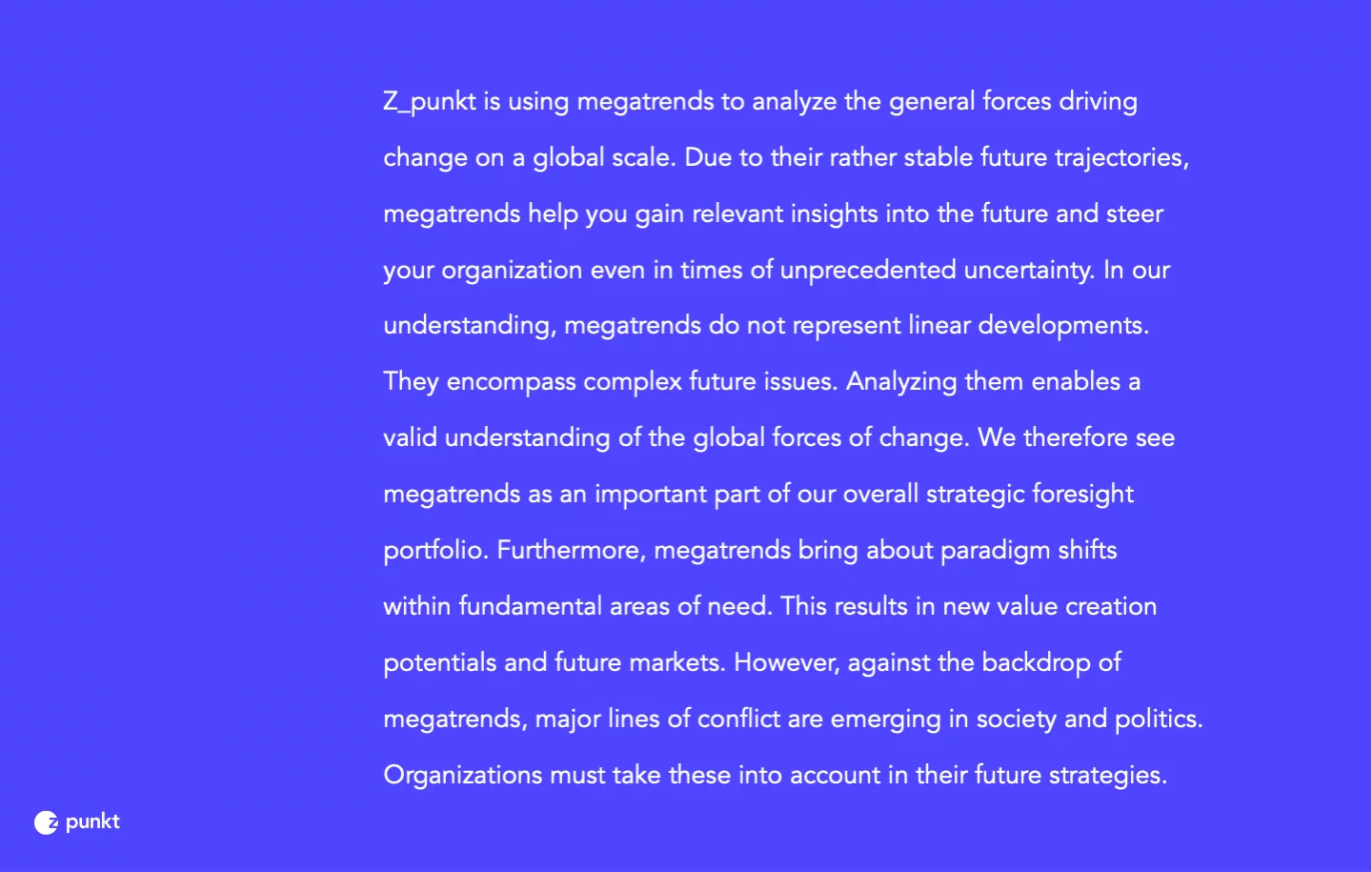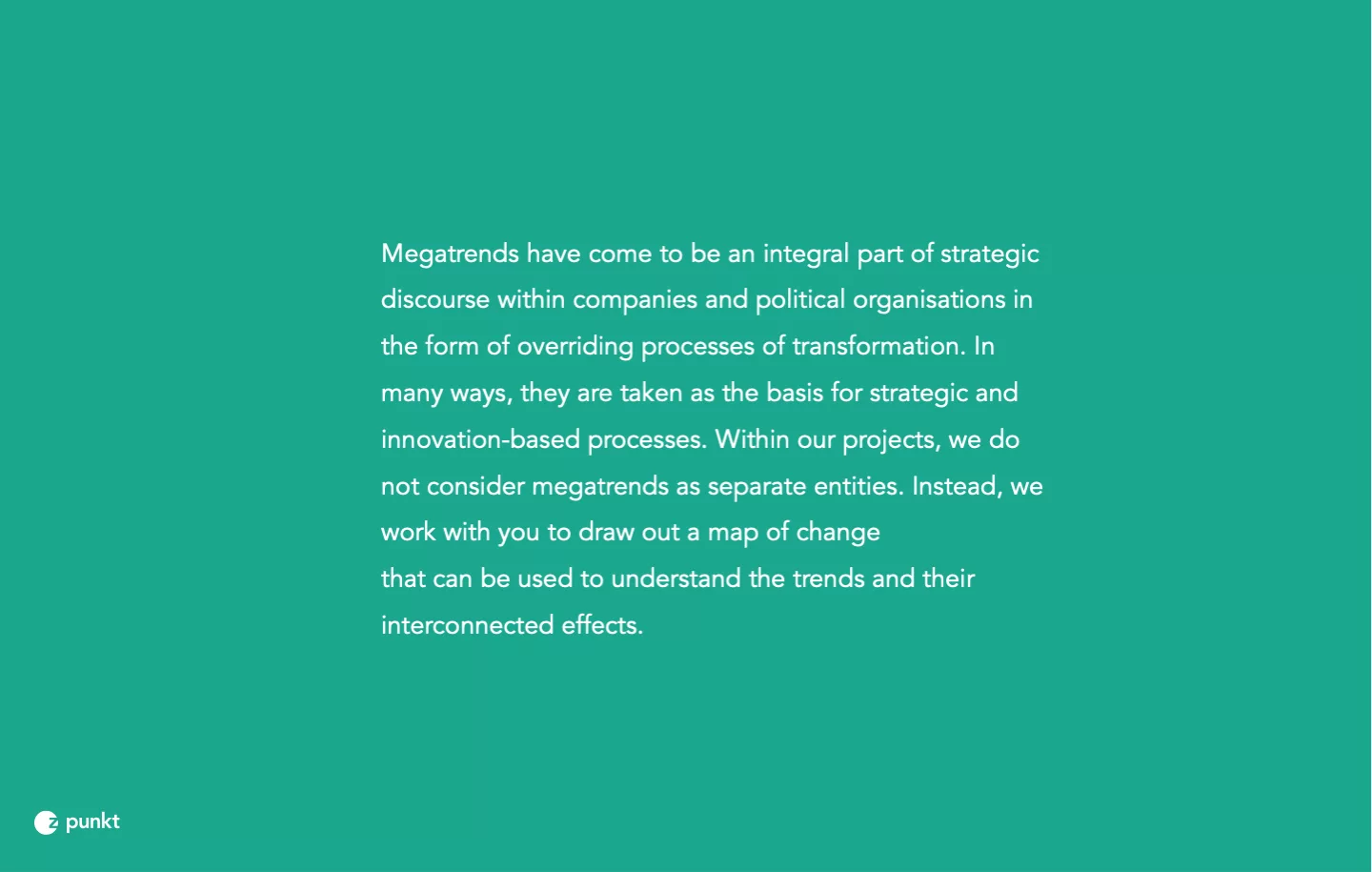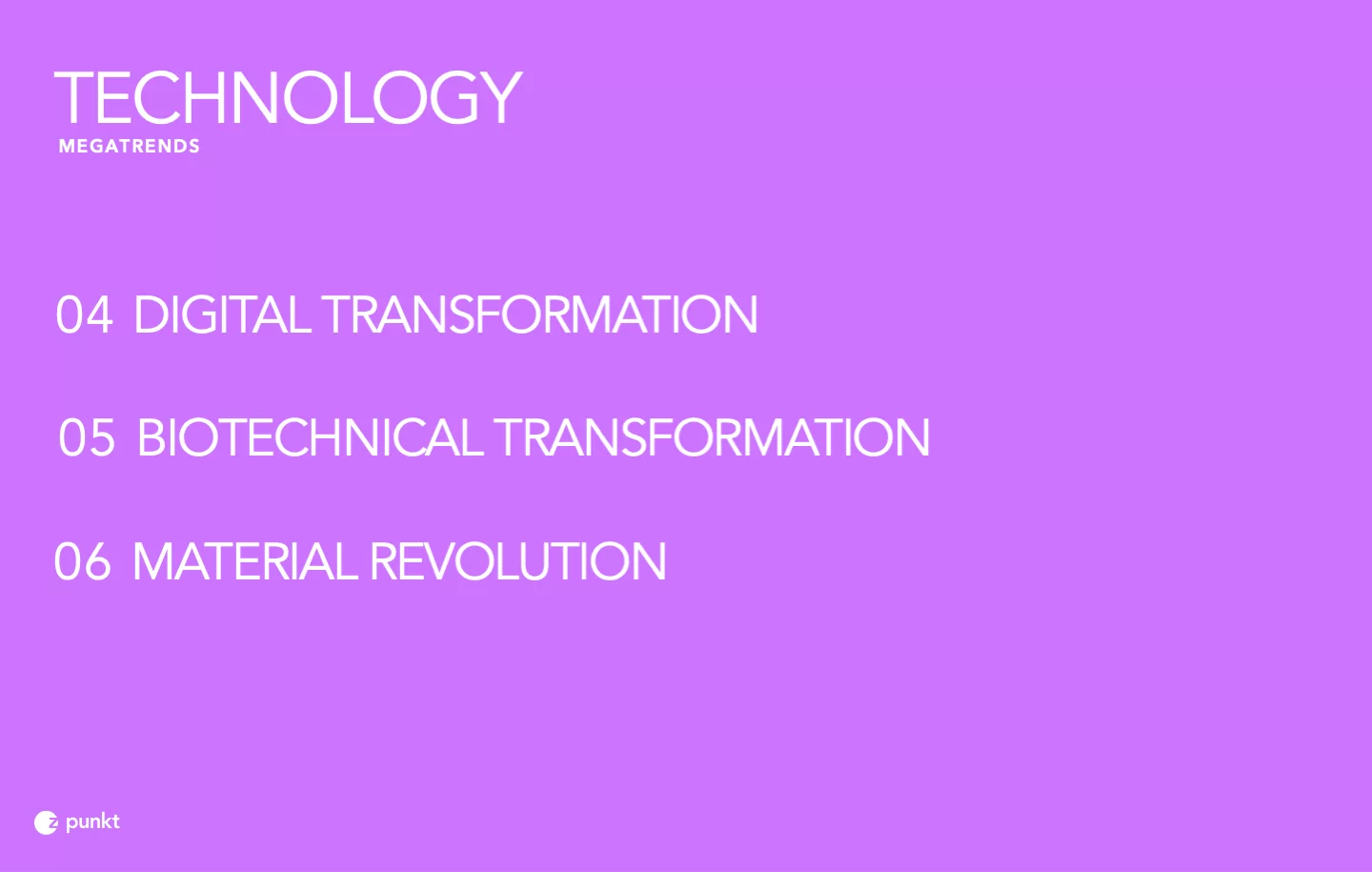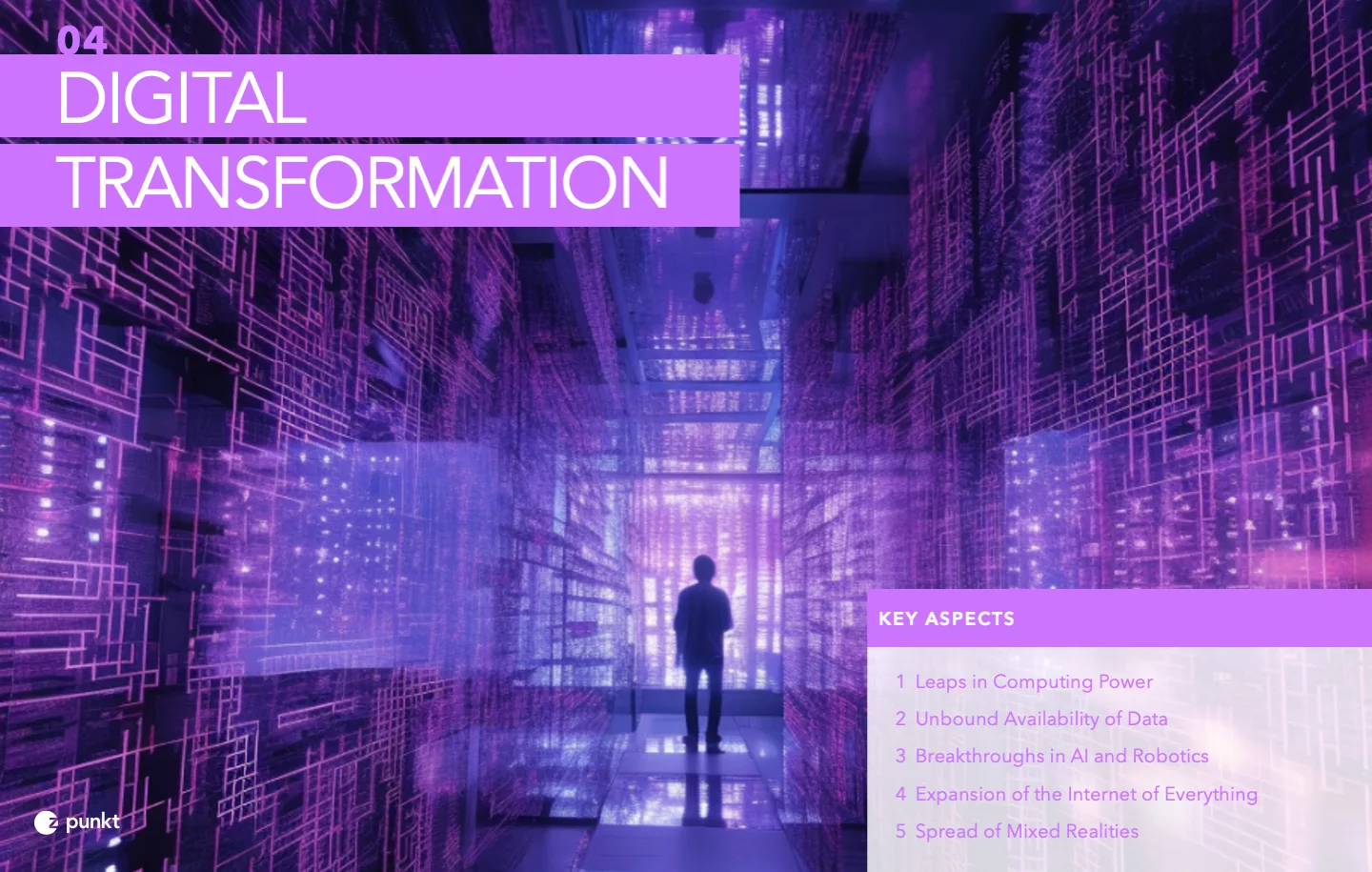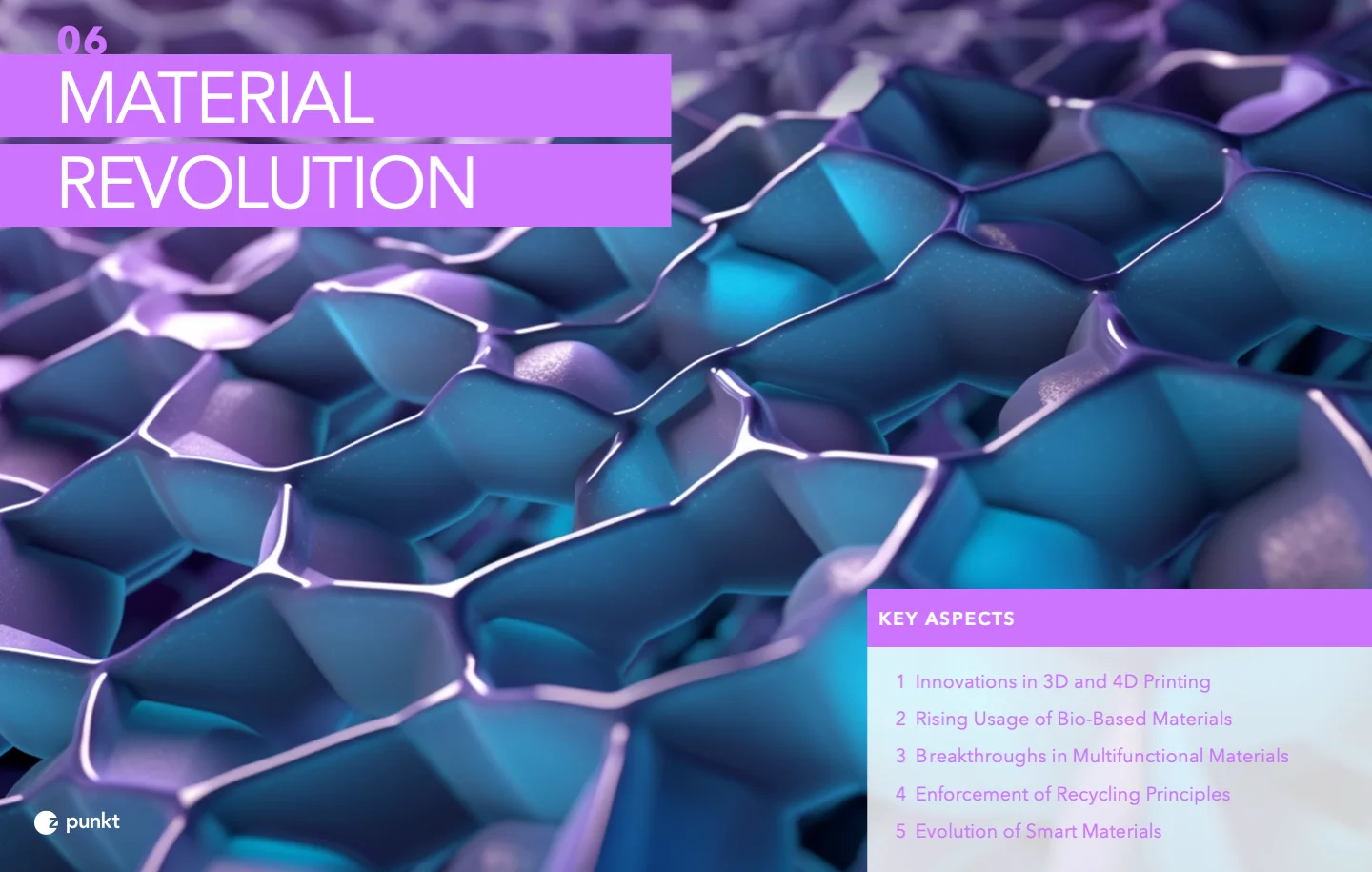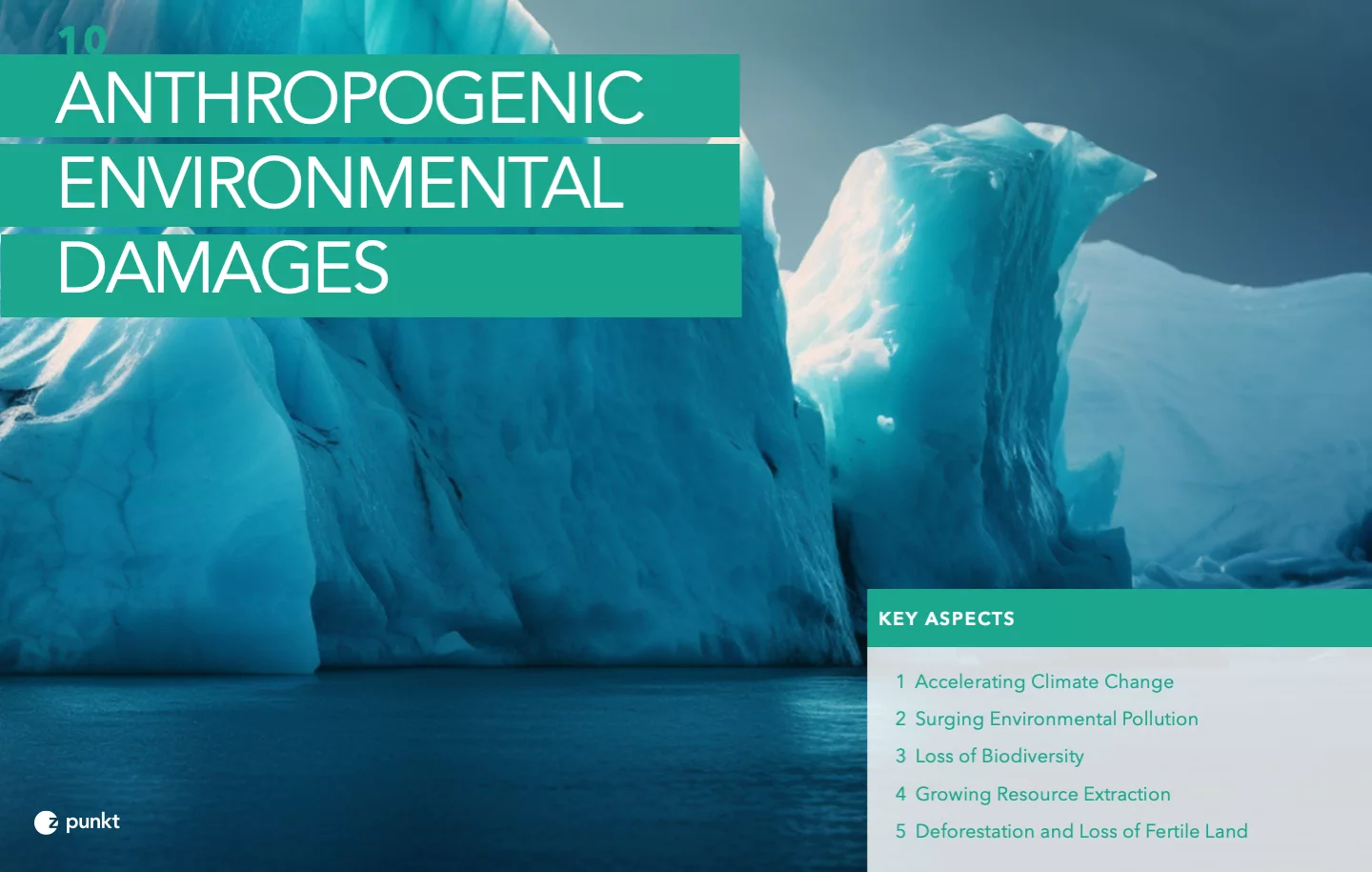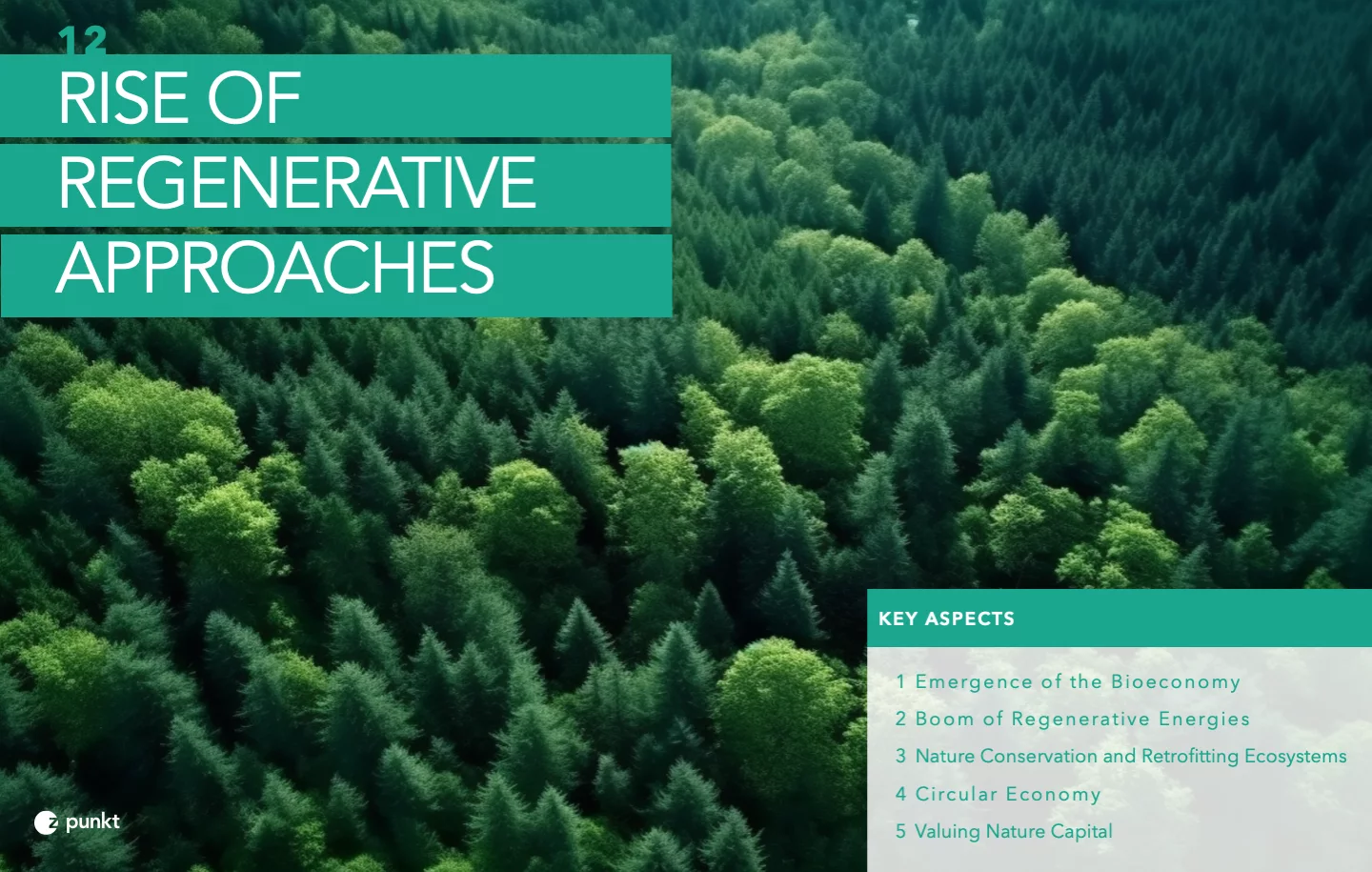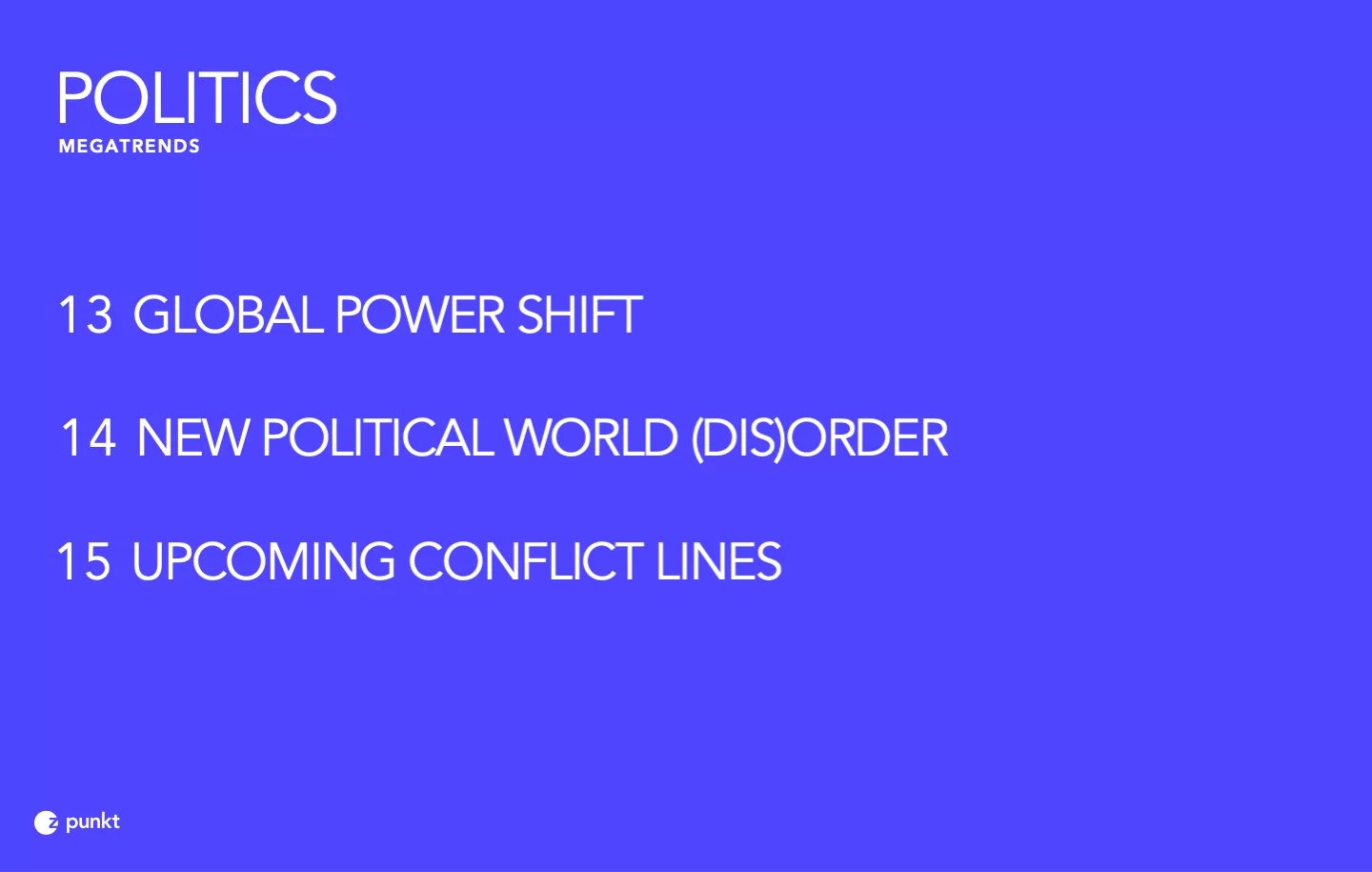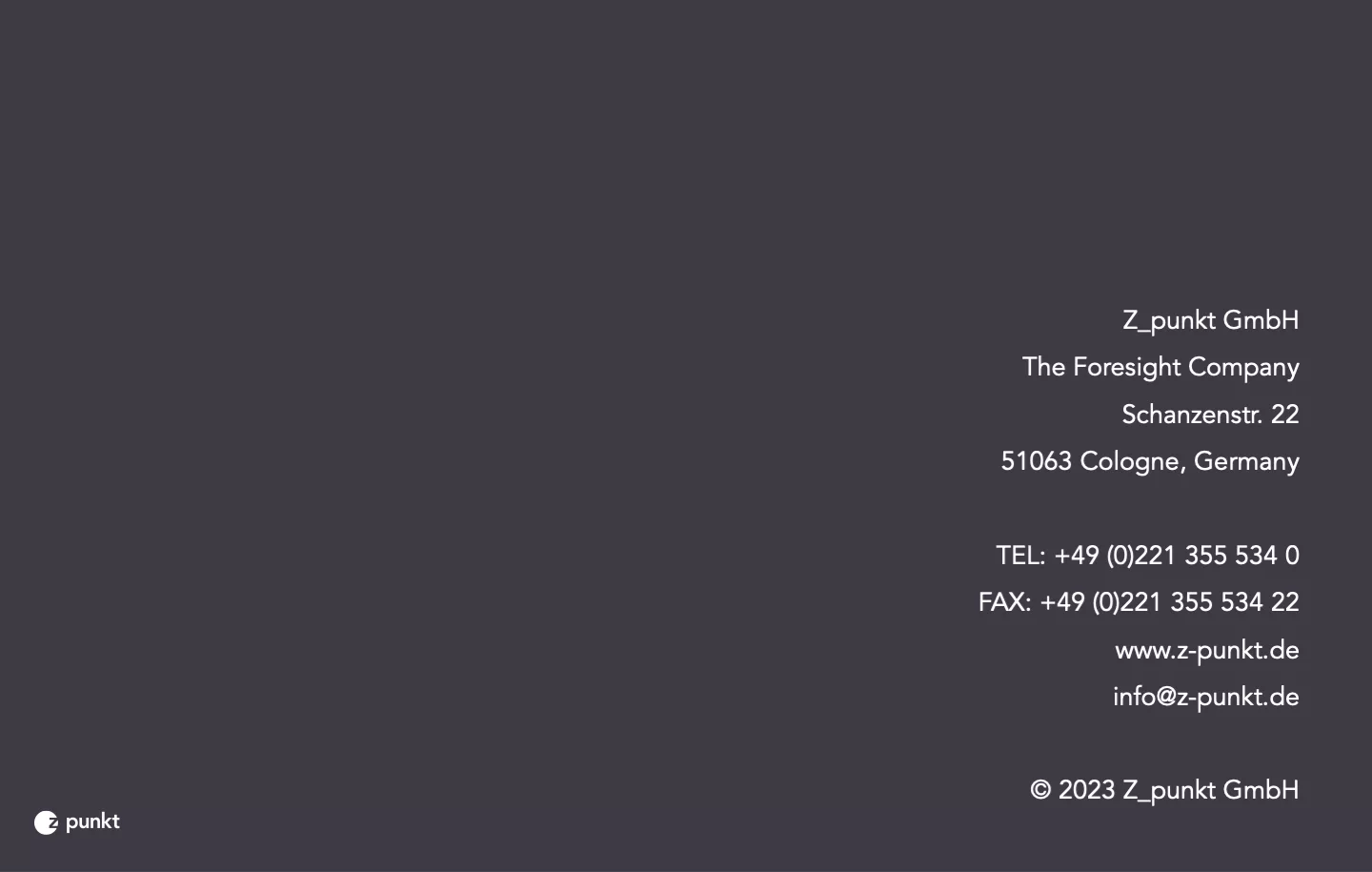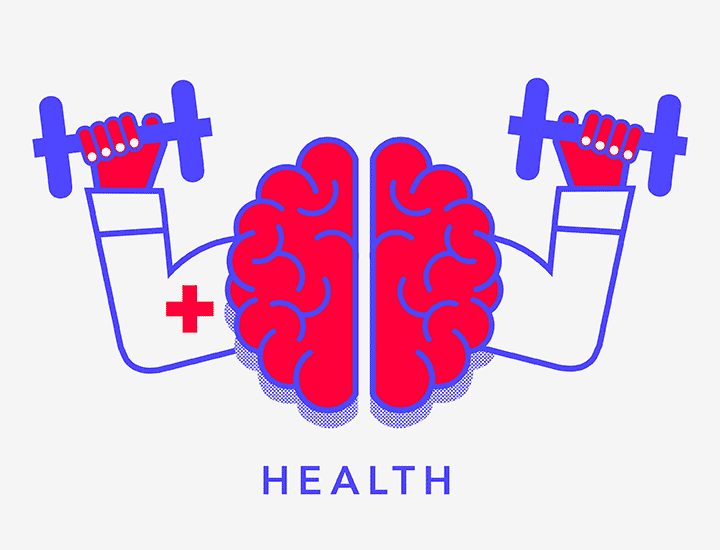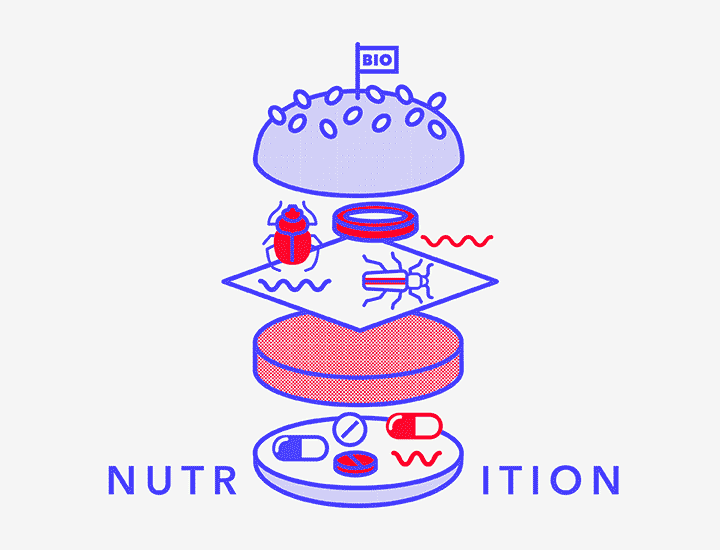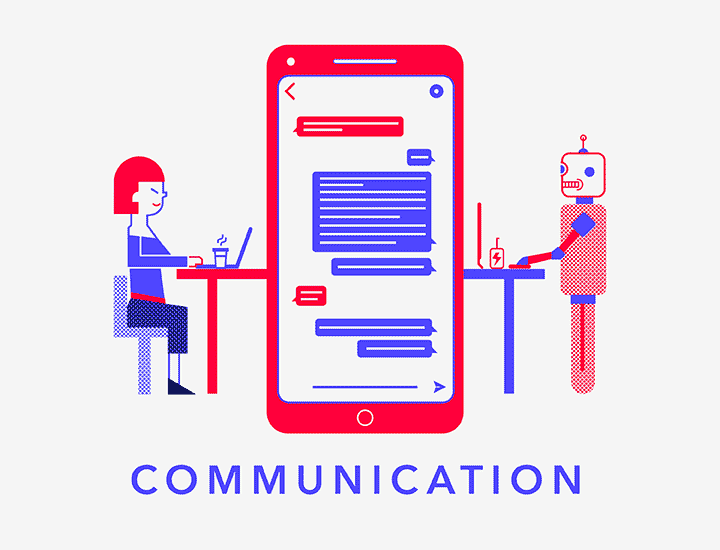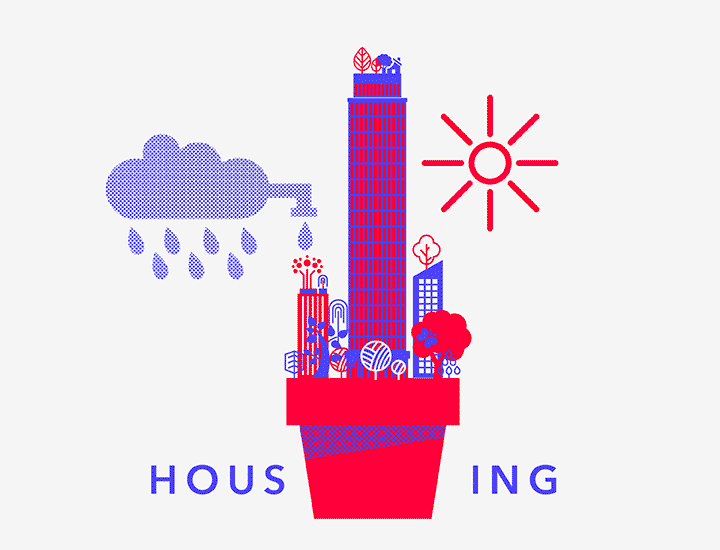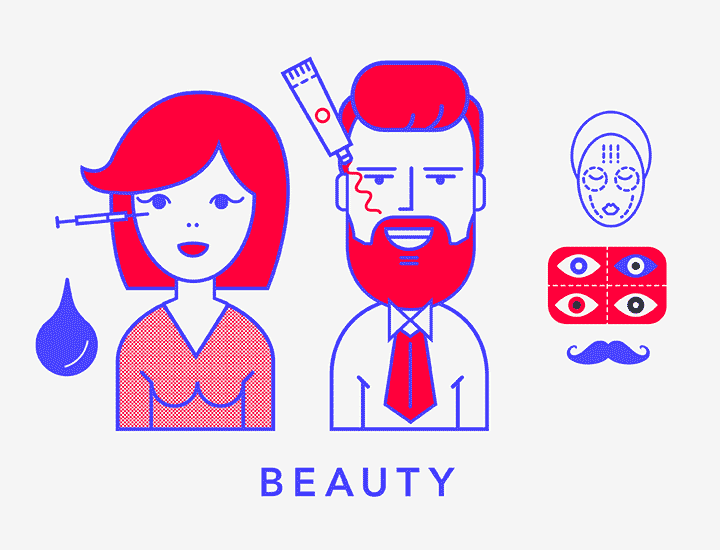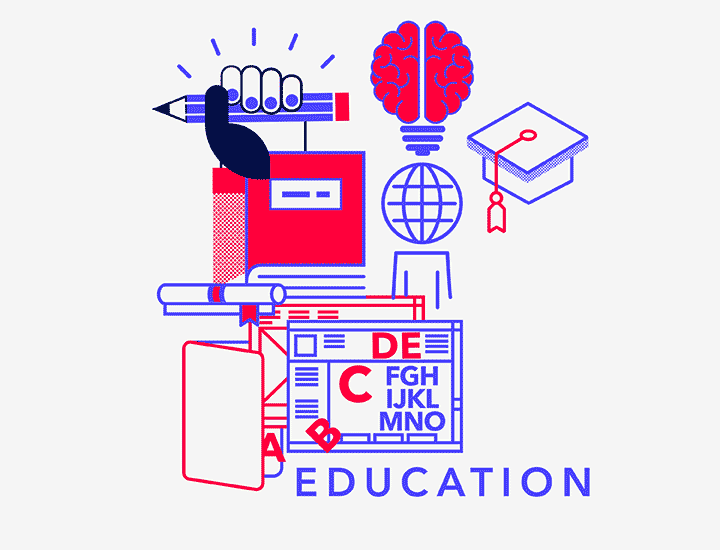Sicher kann man über Schwerpunkte und Formulierungen unterschiedlicher Auffassung sein, aber wir sind überzeugt, dass wir eine profunde Sichtweise auf die globalen Treiber des Wandels vorlegen, um Organisationen jeglicher Coleur strategische Orientierung in Phasen hoher Komplexität und Unsicherheit zu bieten.
Jüngste empirisch-analytische Erkenntnisse über die Nutzung von Methoden der strategischen Vorausschau legen weiterhin nahe, dass in der strategischen Arbeit von Organisationen Trends immer noch häufiger genutzt werden als Szenarien. Wenn man im Rahmen von Trendanalysen auch gewisse Unsicherheiten, die als stabil erkennbar sind, abbildet, ist dies auch nachvollziehbar. Entscheidungen unter Unsicherheiten werden dadurch einigermaßen kalkulierbar. Trends haben eine hohe Transparenz und damit Nachvollziehbarkeit. Und sie verschaffen Legitimität gegenüber internen wie externen Stakeholdern.
Gleichwohl werden die massiven Konsequenzen, die Menschen wie Organisationen z.B. durch den technologischen Wandel oder die geopolitischen und geoökonomischen Verschiebungen erleben werden, durch die Ebene der Trends und Aspekte nicht erfasst und bedürfen vertiefter und spezifischer Analysen.
In unseren Projekten betrachten wir Megatrends nicht isoliert, sondern entwerfen mit Ihnen gemeinsam eine Landkarte des Wandels, mit der die Trends in ihren vernetzten Wirkungen verständlich werden:
- Megatrends: Megatrends sind Treiber des Wandels. Die Transformationsdynamik komprimieren wir für Sie in einem verdichteten Set von 15 Trends. Die Kernaspekte der Megatrends bilden die klassischen Indikatoren des Wandels ab, aber auch neue, diskussionsbedürftige Veränderungen. Sie bieten eine Grundorientierung in einer unübersichtlichen Welt.
- Bedürfnisfelder: Megatrends transformieren menschliche Bedürfnisse. Wir stellen den Megatrends, die Veränderungen aus einer Makro-Perspektive beschreiben, eine Systematik des Mikro-Kosmos menschlicher Bedürfnisse zur Seite. Die Analyse dieser menschlichen Bedürfnisfelder, an denen sich die Kraft der Megatrends aus Sicht von Organisationen in besonderer Weise festmachen lässt, ist ein Kern unserer Foresight-Projekte, da sie attraktive Herausforderungen und Versprechen für die Zukunft beinhalten.
- Zukunftsmärkte: Megatrends treiben Zukunftsmärkte. Aus der Wirkung der Megatrends auf die Bedürfnisfelder entstehen neue Wachstumsfelder und Wertschöpfungspotenziale. In der Projektarbeit mit Ihnen leiten wir gezielt ab, welche neuen Themen für Ihr Unternehmen wichtig werden.
- Konfliktlinien: In Megatrends verdichten sich nicht nur Chancen, sondern auch tiefgreifende Verwerfungen, die zu neuen Konfliktlinien in Gesellschaft und Politik führen. Wir identifizieren mit Ihnen die globalen Risiken, die zukünftig Ihr Geschäft beeinflussen werden.